Wer entscheidet über mich?
Ob ich ich selbst sein kann.
Will. Darf. Muss. Soll.
![]()

Wer entscheidet über mich?
Ob ich ich selbst sein kann.
Will. Darf. Muss. Soll.
![]()

Vor wenigen Tagen erschien in der ZEIT ein Artikel über Schizophrenie, geschrieben aus der Perspektive eines Journalisten, der im eigenen Familienkreis einen Betroffenen hat, der inzwischen im Maßregelvollzug lebt. Ich lese diesen Text als einen wertvollen und ehrlichen Bericht aus der Sicht eines Angehörigen. Die Überforderung, die Angst und die Hilflosigkeit, die der Autor beschreibt, sind nachvollziehbar und verdienen einen öffentlichen Raum.
Gleichzeitig reiht sich auch dieser Artikel in eine Form der Berichterstattung ein, die mir als Schizophreniebetroffene vertraut ist. Es sind Texte über Betroffene, nicht mit ihnen. Die Perspektive der Erkrankten selbst bleibt weitgehend außen vor, ebenso der Dialog mit ihnen.
Auch im aktuellen Artikel erscheinen Betroffene vor allem als entfremdete, kranke Wesen, die sich nicht helfen lassen, von denen man sich abgrenzt und vor denen man sich letztlich schützen muss. Diese Perspektive mag aus der Sicht von Menschen ohne Psychoseerfahrung verständlich sein, bleibt jedoch unvollständig.
Nicht unproblematisch empfinde ich in diesem Zusammenhang auch die im Artikel zitierten Aussagen von Prof. Birgit Völlm. Sie betont einerseits, dass Psychosen infolge von Drogenkonsum oder genetischer Veranlagung entstehen können. Andererseits, dass Schizophrenie gut behandelbar sei und es wirksame Medikamente gebe, ergänzt durch Psychotherapie. Zugleich sagt sie, dass Betroffene häufig nicht in der Lage seien zu begreifen, dass sie krank sind.
Was dabei aus meiner Sicht fehlt, ist eine erweiterte Perspektive: die Erkenntnis, dass psychotische Erfahrungen als Kontinuum verstanden werden und prinzipiell allen Menschen möglich sind (1,2), und dass Psychosen nicht ausschließlich genetisch bedingt sind, sondern auch Ursachen haben können, die im persönlichen Umfeld und in der individuellen Biografie zu finden sind. Ebenso fehlt der Hinweis darauf, dass sich Psychoseanfälligkeit mit Unterstützung des Umfeldes – insbesondere der Familie – deutlich verbessern kann, in manchen Fällen sogar nachhaltig.
Meine Vermutung ist, dass Betroffene dann besonders stark am Wahnkonstrukt festhalten, wenn ihnen keine Hilfe angeboten wird, die sie selbst als hilfreich und zielführend erleben. Der Wahn ist für sie nachvollziehbar. Die Realität hingegen nicht mehr.
Zusätzlich vermute ich, dass viele Betroffene, bevor sie wahnhaft-psychotisch werden, die Welt und sich selbst als zunehmend sinnlos erleben. In der Psychose gewinnt dann alles, was wahrgenommen wird, eine übergroße Bedeutung. Die Welt und das eigene Selbst sind mit einem Schlag wieder voller Sinn.
Wenn Betroffenen diese innere Logik – nämlich Sinn wiederherzustellen, dort, wo er sich zuvor aufzulösen drohte – ausschließlich als Krankheit abgesprochen wird, ohne dass ihre Erfahrungen verstanden oder ernst genommen werden, kann dies meinem Verständnis nach dazu beitragen, dass sich psychotische Zustände verfestigen und chronifizieren.
In unserem persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis kennen wir mehrere Menschen mit einer Schizophreniediagnose, die dauerhaft schwer wahnhaft sind oder waren und deren Familien sowie therapeutisches Umfeld sie innerlich bereits aufgegeben haben – als „zu krank“ oder „zu uneinsichtig“. Einige dieser Menschen leben nicht mehr. Um andere machen wir uns Sorgen.
Was mir in der öffentlichen Debatte weiterhin fehlt, ist eine Perspektive, die Betroffene nicht nur beschreibt, sondern ihnen zuhört. Nicht gegen Angehörige oder Fachleute gerichtet, sondern als notwendiges Gegenüber auf Augenhöhe.
Literatur:
![]()

Anmerkung der Autorin: Dieser Titel ist bewusst provokant. Wenn er Empörung auslöst, während zu wenig Empörung über Kriege und das unermessliche Leid dieser Welt herrscht – wie den von der UN festgestellten Genozid in Gaza durch die israelische Armee und Regierung – dann erfüllt er seinen Zweck.
Hass und Gewalt können in schwierigen Lebenssituationen verständliche, wenn auch unerwünschte Reaktionen sein. Es ist nicht möglich, Gedanken und Gefühle zu verbieten – sie brauchen Raum, um erkannt und verstanden zu werden.
Entscheidend ist, dass ein vernünftiger Mensch zwischen innerem Erleben und äußerem Handeln unterscheiden kann. Gedanken sind nicht gleich Taten. Verhalten lässt sich steuern, anpassen und sozialverträglich gestalten.
Die Gefährlichkeit psychotischer Störungen liegt darin, dass Betroffene im Wahn den Realitätsbezug und damit die Urteilskraft verlieren können. Maßnahmen wie der pauschale Einsatz von Psychopharmaka können jedoch keine alleinige Lösung sein, da das individuelle Risiko nicht vorhersehbar ist. Unterdrückung schafft keine Sicherheit.
In mir selbst erkenne ich Extreme nebeneinander: In meinen Gedanken könnte ich Hitler oder Hirohito sein und ebenso Jesus, und meistens irgendetwas dazwischen. Diese Einsicht zwingt mich, mich selbst zu beobachten und bewusst zu entscheiden, was ich für richtig halte.
Meine Erfahrungen und Beobachtungen zeigen, dass es Wege aus Hass und Gewalt gibt, die nicht auf eskalierender Gegengewalt basieren. Seelische Wunden können heilen, oft besser als gedacht. Diese Wege bestehen in der Bereitschaft jedes Menschen, sich selbst und den anderen wahrzunehmen, ihm zuzuhören, ihn zu verstehen und anzuerkennen. Der andere ist wie ich ein Mensch, der Freiheit und Frieden sucht und leben will.
![]()
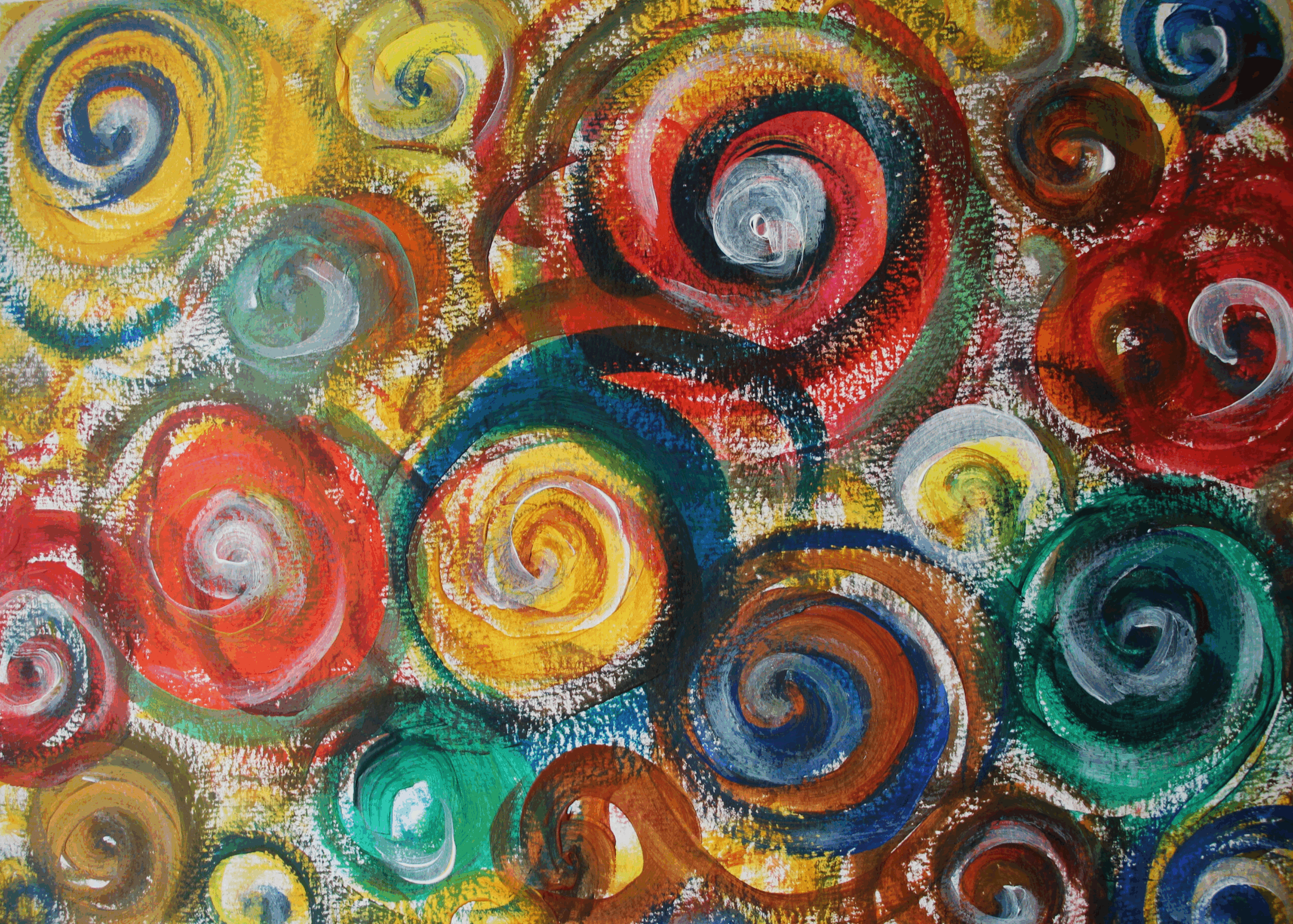
Beim Lesen des Positionspapiers der DGPPN bin ich neulich auf Seite 5 auf das Verb potenzieren in einem für mich neuen Zusammenhang gestoßen:
Sie (Anmerkung der Autorin: die universellen Risikofaktoren für gewalttätiges Verhalten) sind bei Menschen mit psychischen Erkrankungen genau so bedeutsam wie bei gesunden Menschen, und sie wirken sich bei einer psychischen Erkrankung potenzierend auf das Gewaltrisiko aus.
Diese Formulierung führte mich zu dem Gedanken, dass psychische Erkrankungen generell potenzierend auf Störungen und Probleme wirken können. In der Mathematik beschreibt Potenzieren eine nichtlineare Verstärkung. Bezogen auf psychische Erkrankungen verstehe ich das so, dass Belastungen nicht einfach zunehmen, sondern leichter eskalieren und sich der Regulation entziehen können. Dadurch können Menschen leichter in eine gefühlte oder tatsächliche Lebensbedrohung geraten.
Konflikte und Beziehungsprobleme gibt es überall und alltäglich – bei jedem Menschen, in jeder Verbindung, unabhängig vom Gesundheitszustand. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass meine erste Psychose vor 15 Jahren alles zerschellte, was für mich bis dahin selbstverständlich war. Es war ein langer und zäher Weg, die Scherben aufzulesen und mich selbst wiederzuergründen, begleitet von vielfältigen – potenzierenden – gesundheitlichen Schwankungen.
In Betroffenenforen, aktuell auf schizophrenie-online.com, beobachte ich, wie sehr wir mit psychischen Beeinträchtigungen und den daraus entstehenden Stigmatisierungen und sozialen Isolationen hadern. Ich glaube, dass es Menschen mit psychischen Erkrankungen oft unverhältnismäßig schwerer fällt, mit Konflikten und sonstigen Störungen des Lebens umzugehen als Menschen, die psychisch robuster sind.
Deshalb muss es nicht immer an bloßen und einseitigen Vorurteilen oder diskriminierendem Verhalten liegen, wenn psychisch robustere Menschen unter sich bleiben und psychisch weniger robuste Menschen als Folge aus ihren Kreisen ausgeschlossen werden. Denn eine Beziehung mit ihnen bedeutet oft intensivere Zuwendung, mehr Geduld und mehr Beziehungsarbeit. Umgekehrt gibt es sicher auch psychisch weniger robuste Menschen, die bewusst lieber unter sich bleiben, vielleicht weil das gegenseitige Verständnis oft größer ist.
Ohne damit das Beobachtete bewerten zu wollen. Jede Beziehung ist einzigartig – und es liegt an uns selbst, was wir daraus machen.
![]()

Nachdem ich die beiden ZEIT-Artikel von Februar bzw. Mai dieses Jahres als einseitig und stigmatisierend empfunden hatte, war ich zunächst skeptisch, welche Haltung die DGPPN (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V.) in ihrem heute Morgen veröffentlichten Positionspapier vertreten würde. Umso mehr hat es mich gefreut, dass das Papier einen differenzierten Eindruck macht und sich – soweit ich das als Laie beurteilen kann – auf zahlreiche Studien und wissenschaftliche Quellen stützt.
Wie darin unter anderem dargelegt wird, lässt sich nachweisen, dass das Gewaltrisiko bei psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie und anderen psychotischen Störungen erhöht ist. Das individuelle Gewaltpotenzial kann jedoch niemals allein aufgrund einer psychiatrischen Diagnose vorhergesagt werden. Es ist zwar möglich, Risikoprofile zu erfassen, doch auch damit lassen sich gewaltbereite Straftäter:innen vor ihren Taten nicht verlässlich identifizieren. Das erscheint mir plausibel, da ich Gewalt als situativ bedingt erlebe und niemanden grundsätzlich für gewaltfrei halte.
Besonders begrüße ich die klare Forderung nach einer konsequenten psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Auch die Betonung der sozialen und beruflichen Teilhabe halte ich für äußerst wichtig. Ebenso notwendig ist die Thematisierung eines möglichen Ausbaus der gesetzlichen Möglichkeiten zur medikamentösen Zwangsbehandlung in „wenigen ausgewählten Fällen“ – vorausgesetzt, dies geschieht mit größter Zurückhaltung und unter sorgfältiger Abwägung zwischen individuellen Rechten und dem Schutz öffentlicher Interessen.
Was mir im Positionspapier gefehlt hat, ist der Hinweis, dass sich der langfristige Krankheitsverlauf durch gezielte therapeutische Maßnahmen deutlich verbessern kann, sich bei unzureichender Versorgung aber auch erheblich verschlechtern kann. Ziel jeder Behandlung sollte es sein, den Betroffenen ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und gesellschaftlicher Marginalisierung aktiv entgegenzuwirken.
Nicht zuletzt hätte ich mir gewünscht, dass das Papier eine differenziertere und stigmatisierungsabbauende Berichterstattung in den Medien einfordert. Einseitige und stigmatisierende Darstellungen leisten keinen Beitrag zur Gewaltprävention – im Gegenteil. Was wir dringend brauchen, ist eine nachhaltige Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Nur so können mehr Menschen frühzeitig professionelle Hilfe suchen und annehmen, ohne Angst vor Ausgrenzung zu haben.
![]()
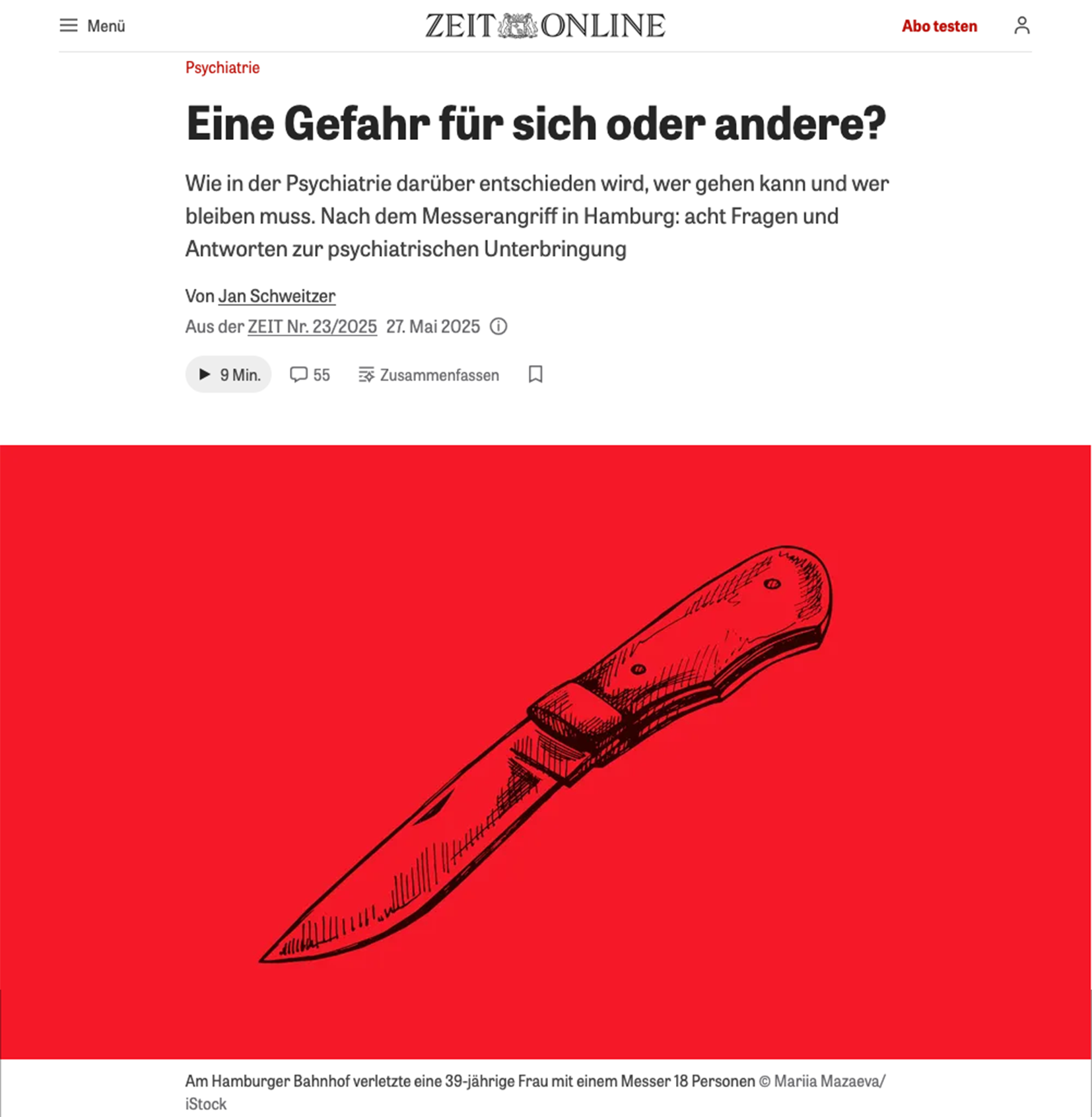
Letzte Woche erschien in der ZEIT ein Artikel, in dem nahegelegt wird, dass Gewalttaten häufig von Menschen mit Schizophrenie begangen würden – und dass diese Menschen Medikamente bräuchten, um das Gewaltrisiko zu kontrollieren. Bereits im Februar veröffentlichte ZEIT Online einen ähnlichen Beitrag, in dem suggeriert wurde, Psychosen seien die Ursache für Amokläufe. Auch dort wurde gefordert, Betroffene notfalls gegen ihren Willen mit Depot-Neuroleptika zu behandeln.
Viele Menschen greifen gleich zu Psychopharmaka, und das ist für mich ein großes Problem. Denn Psychopharmaka heilen nicht, sondern unterdrücken die Ursachen und Symptome psychischer Störungen. Dadurch werden psychische Störungen und damit auch die Menschen, die darunter leiden, unsichtbar. Sie verschwinden aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit – bis die nächste Schlagzeile ruft, wie gefährlich sie sind.
Tatsache ist, dass eine bloße Korrelation noch lange keine Ursächlichkeit ausmacht. Psychische Erkrankungen können auch nicht die alleinige Ursache von Gewalttaten sein, denn sie selbst sind, meiner Meinung nach, nicht selten die Folge erlebter Gewalt. Wenn sich wissenschaftlich nachweisen ließe, dass Psychosen und Schizophrenie das Gewalt- und Amokrisiko steigern, wäre das eine Tatsache, die berücksichtigt werden müsste. In den Zeitungsartikeln wird jedoch nicht auf entsprechende Studien hingewiesen.
Um das Gewaltrisiko in unserer Gesellschaft nachhaltig zu senken, brauchen wir die ernsthafte Bereitschaft aller Mitglieder unserer Gesellschaft, Menschen mit psychischen Erkrankungen und ihrem Leid wahrzunehmen und ihnen zuzuhören. Genau dort beginnt für mich die Heilung. Die Heilung seelischen Leidens, der Wut und der Aggressionen, die erst recht begünstigt werden, wenn sie nicht wahrgenommen werden dürfen und nur unterdrückt werden können.
Ich habe kein Verständnis dafür, wenn in den Nachrichten immer wieder zu lesen ist, dass Menschen mit Schizophrenie die Allgemeinheit gefährden und am besten medikamentös zwangsbehandelt werden müssten. Nein! Genau das ist der falsche Weg, denn er stigmatisiert und erzeugt am Ende nur noch mehr Gewalt.
![]()

Wenn ich heute die Berichterstattung von „Democracy Now!” verfolge, denke ich zurück an eine prägende Phase meines Lebens vor 15 Jahren. Damals erlebte ich meine erste Psychose – kurz nachdem ich, nach der Promotion und meinem ersten Arbeitsverhältnis als postdoktorale Forscherin in London, ein Zweitstudium in Medizin begonnen hatte. Es war mein Versuch, als junge Erwachsene in einer turbulenten, globalisierten Welt meinen Platz zu finden.
In dieser Zeit stieß ich auch auf die Werke von Noam Chomsky und begann, regelmäßig „Democracy Now!” zu schauen. Diese Stimmen halfen mir, das minimale Vertrauen in die Welt zu bewahren, an mich selbst zu glauben – und mit meinen Krisen zu hadern. Heute erfüllt es mich mit Hoffnung, junge Menschen zu sehen, die sich gewaltfrei für Frieden engagieren. Umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass viele von ihnen selbst extreme Gewalt und tiefgreifende Traumata erlebt haben.
Vielleicht habe ich mich im Kern seit damals nicht wirklich verändert. Und doch ist in den letzten 15 Jahren so viel geschehen, dass ich mich frage, ob sich nicht doch alles verändert hat. Das Momentum, mit dem ich als Heranwachsende und junge Erwachsene versuchte, mich selbst und das Leben zu verstehen, lodert bis heute in mir weiter. Ich hoffe, dass ich es nie verliere.
![]()